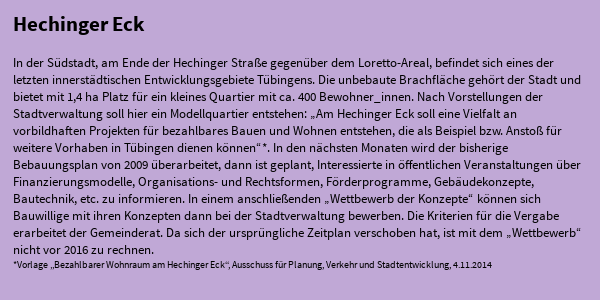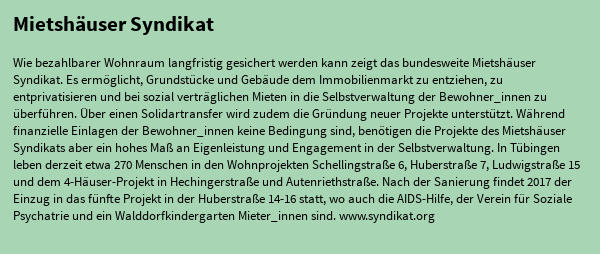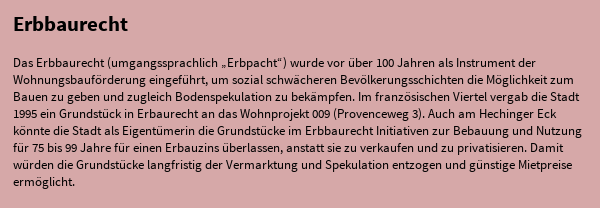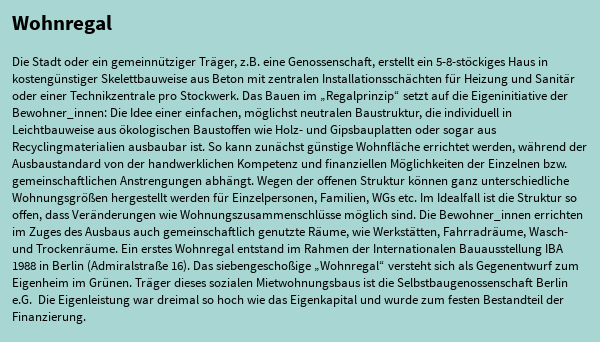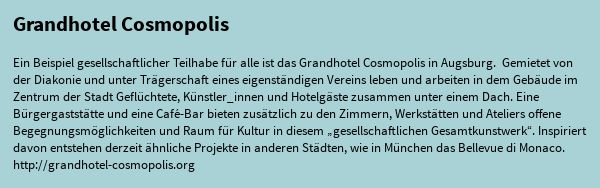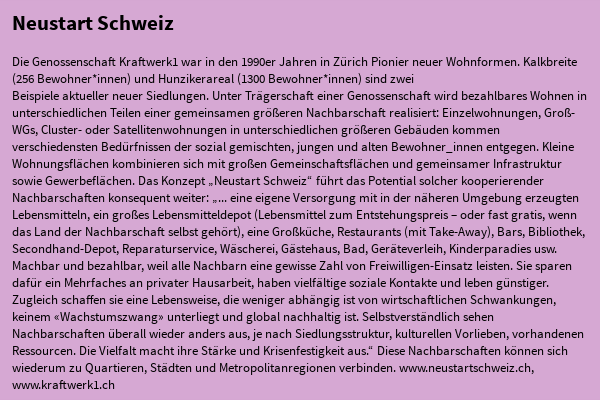Vergesellschaftung von Wohnraum statt Privatisierung
Die Brachfläche am Hechinger Eck in der Tübinger Südstadt ist eines der letzten innerstädtischen Baugebiete Tübingens. Die Stadtverwaltung hat verkündet dort „ein Modellquartier für kostengünstiges Bauen und Wohnen“ entstehen zu lassen, auch, um damit die rasanten Mietpreissteigerungen der letzten Jahre zu dämpfen.
Mit dem vorliegenden Diskussionspapier zum Hechinger Eck möchten wir die öffentliche Debatte weiterführen, in welche Richtung Stadtentwicklung in Tübingen geht und gehen soll: Wer kann sich das Wohnen in Tübingen jetzt und in naher Zukunft noch leisten? Wer profitiert und wer wird verdrängt? Welche ökonomischen Mechanismen greifen und welche politischen Interessen werden verfolgt oder bedient? Wie können die Interessen von Mieter_innen geschützt und durchgesetzt werden, gerade auch derjenigen, die von den Mietpreissteigerungen existenziell betroffen sind?
Diese Diskussion muss sich zwingend auch mit den verstärkten Flucht- und Einwanderungsbewegungen auseinandersetzen. Die Verhältnisse auf dem Tübinger Wohnungsmarkt werden, wenn nicht politisch eingegriffen wird, Menschen aus den Unterklassen noch weit massiver als bisher in Konkurrenz zueinander um die viel zu knappe Ressource „preisgünstiger Wohnraum“ treiben. Die Tendenz ist absehbar, dass die politische Rechte bis weit in die Mitte hinein der Versuchung nicht widerstehen wird, Geflüchtete bzw. Einwanderung zum Kern des Problems zu erklären und damit die Mobilisierung von Ressentiments und rassistischer Reflexe zu betreiben. Gleichzeitig könnten so die zerstörerischen Folgen der profitgetriebenen Verwertung von Grundstücken und Wohnraum zusammen mit den Versäumnissen einer marktgläubigen und neoliberalen kommunalen Wohnbaupolitik seit den 90er Jahren aus dem Fokus der öffentlichen Auseinandersetzung um Wohnungsnot genommen werden. All dem gilt es aus unserer Sicht entschlossen entgegen zu treten. Um bezahlbaren Wohnraum und das Recht auf Stadt für alle zu sichern bzw. wieder neu zu erringen, müssen – so unsere Schlussfolgerung als These vorweg – vor allem die Eigentumsverhältnisse geändert werden. Statt Privatisierung und Verwertung braucht es eine umfassende Vergesellschaftung von Wohnraum.
Im Folgenden stellen wir unsere Überlegungen genauer dar und beschreiben beispielhaft praktische Ansätze, die aus unserer Sicht in die richtige Richtung weisen.
Wohnen in Tübingen wird immer teurer – die Universitätsstadt ist inzwischen die teuerste Stadt Baden-Württembergs und viertteuerste Stadt Deutschlands. Mit neuen Stadtvierteln wie dem Französischen Viertel, Loretto, Mühlenviertel, Alte Weberei und künftig zusätzlich mit dem Güterbahnhof-Areal wurde zwar viel neuer Wohnraum geschaffen und durch städtebauliche Konzepte in diesen Vierteln eine hohe Wohn- und Lebensqualität erreicht, doch änderten diese nichts an der Tendenz steigender Mieten. Im Gegenteil: Die Attraktivität Tübingens wächst gerade wegen der hohen Wohn- und Lebensqualität mit überschaubaren und doch urbanen Strukturen sowie vergleichsweise guten sozialen und kulturellen Angeboten.
Entsprechend steigt die Nachfrage nach Wohnraum und damit steigen die Mietpreise. Zunehmend wird die Stadt dadurch auch attraktiv für renditeorientierte Kapitalanlagen. Wer es sich leisten kann, ist bei all dem dabei und zahlt eine Miete von 12€/m² und mehr. Wer das nötige Geld hat sowie Zeit und entsprechende Kompetenzen mitbringt, steigt in eine Baugemeinschaft ein und schafft sich damit auf verhältnismäßig günstige Art Wohneigentum – oder kauft sich über den Immobilienmarkt eine Eigentumswohnung der städtischen GWG oder von Immobilienfirmen. Wer in schlechter bezahlten Jobs arbeitet, wer alleinerziehend ist, wer keinen „deutschen“ Nachnamen oder gesicherten Aufenthaltsstatus hat oder wer erwerbslos ist, hat auf dem freien Wohnungsmarkt in der Konkurrenz mit Bessergestellten um die wenigen Mietwohnungen im mittleren und unteren Preissegment meist keine Chance mehr. Mietsteigerungen anlässlich Sanierung oder Eigentümerwechsel verdrängen immer mehr Mieter_innen, die sich ihre teilweise seit Jahrzehnten gemieteten Wohnungen nicht mehr leisten können, ins Tübinger Umland.
Mit dem „Modellquartier Hechinger Eck“ (-> siehe Kasten) möchte die Stadtverwaltung Möglichkeiten ausloten, wie parallel zum scheinbar unaufhaltsamen Steigen von Mietpreisen Akzente für mehr kostengünstigen Wohnraum gesetzt werden können. Sie greift dazu nach eigenen Angaben auf erprobte Konzepte zurück wie die Nutzungsmischung von Wohnen und Arbeiten sowie die Kleinteiligkeit der Träger- und Baustrukturen. In einem sogenannten „Wettbewerb der Konzepte“ soll über die Vergabe der Bauplätze entschieden werden. Dabei behauptet die Stadtverwaltung, bisherige Erfahrungen mit dem „Tübinger Modell“ kritisch überprüfen zu wollen: Etwa, dass Gewerbe im Erdgeschoss zu höheren Wohnungsmieten führten, dass die Parzellierung in kleine Bauten höhere Kosten verursachte als bei Großbauten oder dass Tiefgaragenstellplätze das Wohnen verteuerten.
Parallel dazu wird allerdings an anderen Stellen in Tübingen extrem hochpreisiger Wohnraum entstehen (zum Beispiel am Güterbahnhof) und angesichts der wenigen noch vorhanden Entwicklungsflächen in Tübingen kommt die Idee, kostengünstiges Wohnen zu fördern, reichlich spät. Nach der neoliberalen Logik kann die Stadt nebenbei mit einem halbwegs erfolgreichen und öffentlich wahrgenommenen Modellprojekt möglicherweise einen Imagegewinn verbuchen, der die „Kosten“ des Versuches wieder aufwiegt, indem er die Stadt in der Außenwahrnehmung nur noch attraktiver macht. Das wirkt wiederum preistreibend und so könnte der Ansatz, dem Preisauftrieb auf dem Wohnungsmarkt entgegen zu wirken, bereits wieder konterkariert sein, wenn es denn bei dem einen kleinen Modellprojekt bliebe. Eine veränderte Prioritätensetzung wäre mit einem erfolgreichen Modellprojekt auch deshalb noch lange nicht gegeben, weil es zunächst den Investoreninteressen nicht weh tut und auch das Grundsteueraufkommen – angesichts der überschaubaren Größe des Hechinger Ecks – kaum negativ beeinflussen wird. Ob die Verwaltung die proklamierten Ziele am Hechinger Eck ernsthaft verfolgt und wie sich die Erfahrungen aus dem Modell in der zukünftigen Wohnungsbau-Politik niederschlagen, wird wesentlich von einer hoffentlich regen gesellschaftlichen Debatte und Auseinandersetzung abhängen.
Vergesellschaftung, Eigentumsneutralisierung, Gemeineigentum
Bezahlbarer Wohnraum FÜR ALLE ist ohne ein aktives und weitgehendes Eingreifen in die Logik des Marktes nicht zu haben. Es wird sich zeigen, wie weit oder wie eng die Stadt die Grenzen des Modells in dieser Hinsicht zu ziehen bereit ist. Wenn das Hechinger Eck also tatsächlich Modellcharakter haben soll für einen anderen Umgang mit Wohnungsnot, steigenden Mieten und Verdrängung, müssen daraus Perspektiven sichtbar werden hin zu einer Vergesellschaftung von Wohnraum in größerem Maßstab. Vergesellschaftung meint, Wohnraum/Baugrund aus privatem Eigentum in gesellschaftliche/gemeinschaftliche Verfügung zu überführen mit einem städtischen oder gemeinnützigen Träger. Gesellschaftliche Verfügung beinhaltet, dass niemand mehr zu privaten Zwecken mit dem Wohnraum oder dem Recht, darin zu wohnen, handeln kann. (Mehr zum Thema „Vergesellschaftung & Soziale Infrastruktur“ auf unserem Alternativen Stadtplan „Wohnen – Ware oder Gemeingut“ oder auf unserer Internetseite https://il-tue.mtmedia.org/wohnen-in-tuebingen.) Eine Perspektive hin zu Vergesellschaftung von Wohnraum aber wird zum Einen den Interessen von Immobilienverwertern entgegen stehen und es wird sich zum Anderen auch im städtischen Haushalt rein finanztechnisch kaum auf der Habenseite auswirken. Ob Verwaltung und Gemeinderat unter den bestehenden gesellschaftlichen Vorzeichen und Kräfteverhältnissen dem Menschenrecht auf eine angemessene Wohnung Vorrang geben und so überhaupt über das kleine Quartier am Hechinger Eck hinaus denken möchten, wird die spannende Frage sein. Für uns wären in einem wirklichen Modellprojekt folgende Aspekte von zentraler Bedeutung:
Erstens wären Eigentumsmodelle notwendig, die, anstatt privates Eigentum zu schaffen, die Eigentumsrechte an neu zu schaffendem Wohnraum neutralisieren. Dafür sind private Bauträger, die aus Investitions- und Verwertungsgründen bauen und vermieten, denkbar schlechte Partner. Selbst die Vergabe von Bauplätzen an Baugemeinschaften, die den Zugriff des „freien“ Marktes auf den Baugrund erschweren soll, konnte in der Vergangenheit gezielte Verwertungsprozesse nicht verhindern. So wurden Wohnungen in Baugemeinschaften schon kurz nach Fertigstellung zu weit über den Baukosten liegenden Preisen verkauft. Privateigentum an Wohnraum wird immer mit profitorientierten Prozessen von Kauf und Verkauf einhergehen. Stattdessen müssen Modelle erarbeitet und genutzt werden, die diese Prozesse auf lange Sicht unmöglich machen. Das Mietshäuser Syndikat (-> siehe Kasten) ist ein gutes Beispiel dafür, wie selbstorganisiertes, kreatives und günstiges Wohnen mit der Neutralisierung von Eigentumstiteln einhergehen kann. Allerdings möchte und kann nicht jede_r in einem der bestehenden Wohnprojekte wohnen und noch weniger können alle, die Bedarf an kostengünstigem innerstädtischem Wohnraum haben, sich auf den langen, sozial und kommunikativ sehr fordernden Prozess einlassen, den es braucht, ein neues Projekt zu gründen. Neben solchen Nischen wird es daher notwendig sein, weitere Wohnformen jenseits privater Verwertungsinteressen zu schaffen. Zu denken wäre dabei an Organisationsformen wie Genossenschaften, Stiftungen und Vereine kombiniert mit bestehenden öffentlichen Eigentumsformen wie dem Erbbaurecht (-> siehe Kasten).
Zweitens müsste kommunaler Wohnraum – mit konzeptionellen Grundideen versehen – bereit gestellt werden, um kostengünstiges Wohnen in guter Stadtlage auch denen zur Verfügung zu stellen, die sonst im Wettbewerb um Wohnungen wenig Chancen haben. Kommunaler Wohnraum würde in diesem Kontext nicht nur die Stadt als Eigentümerin bedeuten, sondern wäre durch Verfügungs- und Selbstverwaltungsmöglichkeiten der Mieter_innen zu ergänzen. Damit würde sich „kommunaler Wohnraum“ vom Modell des sozialen Wohnungsbaus deutlich unterscheiden, das Betroffene nicht ermutigt und befähigt, sondern verwaltet und verwahrt. Und das schon allein deshalb zwiespältig ist, weil die Wohnungen nach 10-25 Jahren ihre Mietpreisbindung verlieren und dem Markt wieder unbegrenzt zur Verfügung stehen.
Der kommunale Wohnungsbau könnte ergänzt werden durch Formen Gemeinwesen orientierten Bauens, die Eigenbeiträge der Mieter_innen/ Nutzer_innen aktiv einbeziehen. Die Eigenbeiträge könnten z.B. im Ausbau von Gemeinschaftsflächen in Eigenarbeit bestehen, die dann für mehrere Gebäudeeinheiten zusammen zur Verfügung stehen. Oder es könnten städtebauliche Ideen aufgegriffen werden wie z.B. die des Wohnregals (-> siehe Kasten). Auch hier wären zur weiteren Verfügung Erbpachtformen und Genossenschafts- oder Stiftungsstrukturen mit Sperrminoritäten sinnvoll, die den weiteren Verkauf des so entstandenen Wohnraums verunmöglichen. Natürlich müssten dabei viele Fragen bedacht und beantwortet werden wie Sicherheitsstandards, Ökologie, Verfahrensweisen usw. Dies – und damit sind wir wieder am Anfang – bedarf aber eines längeren Konzeptionsprozesses, aus dem die Stadt sich nicht heraushalten kann nach dem Motto „der Wettbewerb der Ideen wird es schon richten“, sondern den sie mit potentiellen Interessenten und mit zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammen aktiv gestalten muss. Das beinhaltet selbstverständlich auch den Einsatz kommunaler Mittel.
Die absehbar kaum abebbende Einwanderungsbewegung von Geflüchteten und Migrant_innen stellt neue Anforderungen an Art und Umfang kommunalen Wohnungsbaus. Im besten Fall eröffnet eine Politik der Eigentumsneutralisierung, des Gemeineigentums und kostengünstigen Bauens und Wohnens auch Möglichkeiten für neue, emanzipatorische Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die Antworten auf zentrale Fragestellungen geben können: Wie können ausreichende dezentrale Wohnmöglichkeiten in einem Umfeld geschaffen werden, das willens und dazu in der Lage ist, Neuankömmlinge zu unterstützen und ins soziale Leben einzubeziehen, also Inklusion nicht nur zu propagieren, sondern auch praktisch umzusetzen? Wie können ganz allgemein schon im Planungsprozess Bedingungen dafür geschaffen werden, Zusammenarbeit und Zusammenhalt im Haus und über einzelne Wohneinheiten, über persönliche Hintergründe und Generationen hinweg zu erzeugen und zu stärken? Was kann getan werden, um Menschen im Alltag in das neue Viertel zu führen, so dass dort keine isolierte Insel entsteht? Auch da gibt es mögliche Vorbilder, wie z.B. das Grandhotel Cosmopolis in Augsburg (-> siehe Kasten), das unter einem Dach Künstlerateliers, Flüchtlingswohnungen und ein Hotel mit offenem Gastronomie- und Kulturbetrieb zusammenbringt. Dass Flächen wie das Hechinger Eck anstatt von einzelnen kleineren Bauträgern auch als zusammenhängende, kooperative Nachbarschaften entwickelt werden können, zeigen aktuelle Beispiele in der Schweiz. Größere gemeinschaftliche Räume und gemeinsame Infrastruktur werden mit kleineren privaten Einzelflächen kombiniert. Das bringt soziale und ökologische Vorteile ebenso wie finanzielle. Träger sind auch hier Genossenschaften. Das Konzept Neustart Schweiz (-> siehe Kasten) zeigt die positiven gesellschaftsverändernden sozialen und ökologischen Potentiale solcher Nachbarschaften.
Was tun?
Die dargestellten Beispiele können selbstverständlich nicht am grünen Tisch verordnet und umgesetzt werden, sollten aber unseres Erachtens als Anregungen in den konzeptionellen Prozess einfließen und für das Hechinger Eck ausgelotet werden. Die Problematik der immer weiter steigenden Mieten werden sie aber nicht lösen. Verglichen mit der riesigen Masse des nach Anlagen suchenden Immobilienkapitals, das sich täglich um den Globus bewegt, ist es kaum ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn einige Grundstücke und Neubauten dem privaten Wohnungsmarkt entzogen werden. Trotzdem: Das Hechinger Eck kann im besten Fall die Schwerpunkte in Tübingen verschieben und gleichzeitig aufzeigen, dass es Möglichkeiten jenseits der Marktlogik gibt und dass sie für die Lösung der aktuellen Probleme nur dort gefunden werden können. Vergesellschaftung von Wohnraum, selbstorganisierte Projekte, ergänzt um eine kommunale soziale Infrastruktur, die allen zur Verfügung steht, insbesondere denen, die sonst keinen ausreichenden Zugang zu Wohnungen und städtischen Dienstleistungen haben. Das zeigt in eine Richtung, in der die Menschen weitgehend selbst darüber entscheiden können, wie und wo sie wohnen wollen. Wir geben uns jedoch keinen Illusionen hin. Papiere wie dieses und Appelle an die politisch Verantwortlichen werden nicht ausreichen, den Lauf der Dinge in eine andere Richtung zu lenken. Es geht nicht nur darum, in einigen Häuserblocks etwas ein wenig anders zu machen. Anstatt Rendite und Verwertung wollen wir soziale Phantasie und Vergesellschaftung setzen. Wir wollen deshalb auch dazu ermutigen, sich aktiv dem stummen Zwang der Verhältnisse zu widersetzen, der auf gnadenlose Konkurrenz um Wohnraum, auf Mietsteigerungsspiralen und auf Verdrängungsprozesse hinausläuft. Das kann mit dem öffentlich Machen skandalöser Praktiken von Vermieter_innen und Immobilienunternehmen beginnen, kann bedeuten, sich in Stadtteilen und in den neu entstehenden Vierteln in Nachbarschaftsinitiativen zusammen zu schließen und kann in einer städtischen Bewegung gipfeln, die umfassend für kostengünstigen Wohnraum und ein Recht auf Stadt für Alle einsteht. Und Tübingen hat ja eine reichhaltige Geschichte der selbstorganisierten Aneignung von Wohnraum durch Hausbesetzungen, von Wohnprojekten unterschiedlichster Art und einer lebhaften Debatte um alltagstaugliche Stadtviertel. Wenn einiges davon zusammen kommt, könnte tatsächlich ausgehend von einem kleinen Viertel die städtische Wohnungspolitik und das dahinter stehende Denken die Richtung wechseln.